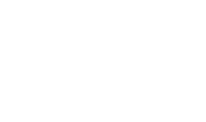Deutsche Polizeidienststellen in der Sowjetunion
Geschichte des Bestandsbildners Bestandsgeschichte Der Bestand setzt sich aus Akten, die bei Kriegsende von der US-amerikanischen Besatzungsmacht beschlagnahmt und später an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben worden waren, sowie aus Unterlagen der Abwicklungsstelle des HSSPF Russland-Mitte und Sachakten des NS-Archivs zusammen. Archivische Bearbeitung Die Bewertung und Verzeichnung erfolgte vorrangig in der Dienststelle Koblenz des Bundesarchivs. Das vorliegende Findbuch basiert auf dem dort erarbeiteten vorläufigen Findbuch. Die in den Bestand integrierten Archivalien des NS-Archivs (67 AE) liegen größten Teils als Kopien von Akten vor, die in Archiven der ehemaligen Sowjetunion verwahrt werden und in der Dienststelle Berlin des Bundesarchivs bearbeitet wurden. Bestandsbeschreibung HSSPF für das Ostland und in Russland-Nord (25), BdO Ostland (20), HSSPF Russland bzw. Russland-Mitte und Weißruthenien (41), KdS Minsk (25), HSSPF Russland-Süd, Schwarzes Meer und Kaukasus z.b.V., HstSSPF Ukraine (19), BdS Kiew bzw. Ukraine (16), KdO Rostow/Kuban (2), Einsatzgruppen im Bereich der UdSSR (6) Erschliessungszustand Findbuch 1975, Findbuch 2008 (online) Zitierweise BArch R 70-SOWJETUNION/... Geschichte des Bestandsbildners Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde. Der Angriff auf die Sowjetunion war mit einer von vornherein konzipierten Kompetenzentgrenzung der Organe von SS und Polizei verbunden. Die effektivste Durchsetzung des nationalsozialistischen Besatzungsprogramms, wie es in der besetzten Sowjetunion mit der mit Abstand größten Brutalität vollzogen wurde, der Volkstumspolitik und Vernichtung der weltanschaulichen Gegner sowie der jüdischen Bevölkerung verlangte in den Augen der deutschen Führung nach einer anderen organisatorischen Grundlage als jener, welche dem deutschen Besatzungsregime in Westeuropa zugrunde lag. Die Erfahrungen des Polenfeldzuges etwa, während dem sich Wehrmachtsstellen teilweise entsetzt über das Vorgehen von SS- und Polizeikräften gezeigt hatten, wurde so in aller Konsequenz von der deutschen Führung zum Anlass genommen, im Falle der Sowjetunion schon im Vorfeld in Absprache mit der Wehrmachtsführung organisatorische Vorbereitungen zu treffen, die den SS- und Polizeieinheiten den größtmöglichen, von regulären Organen der Wehrmacht aber auch der - wo bereits effektiv vorhandenen - Zivilverwaltung weitgehend Spielraum gewähren sollten. So kam es etwa dazu, dass der Zuständigkeitsbereich der Militärverwaltung entgegen gängiger Praxis auf das eigentliche Kampfgebiet eingeschränkt wurde. Hinter den Linien sollte möglichst unmittelbar der nominelle Befugnisbereich der Reichskommissare beginnen. Auch waren die Einheiten von SS und Polizei im rückwärtigen, noch der Aufsicht des Militärs unterstehenden Heeresgebiet der örtlichen Wehrmachtsführung allein in logistischen Fragen unterstellt, konnten ihrem Auftrag also weitgehend reibungslos nachgehen. So waren die Befugnisse von SS und Polizei im besetzten Gebiet der Sowjetunion alles in allem wesentlich stärker ausgeprägt als in den besetzten Ländern Westeuropas, stärker noch als im Falle Polens, wo die Einsatzkommandos der Polizei und des SD in ihren Aktivitäten wenigstens bis Ende Oktober des Jahres 1939 noch durch die Gerichtshoheit der Militärverwaltung zumindest nominell eingeschränkt waren. Reibungen ergaben sich vor allem, da der dortige HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger (1894-1945), sich in einer fortwährenden Kompetenzauseinandersetzung mit Generalgouverneur Hans Frank (1900-1946) befand. Zwar gab es auch hinsichtlich der besetzten Sowjetunion Kompetenzkämpfe zwischen der Zivilverwaltung und der SS, diese fanden aber in erster Linie zwischen Alfred Rosenberg (1893-1946) in seiner Funktion als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete (RMbO)) und Heinrich Himmler (1900-1945) persönlich statt, ohne in der Regel am Ort des eigentlichen Geschehens, in den besetzten Gebieten, weiterreichende Wirkung auf die Praxis von SS und Polizei zu haben. Vor allem die wesentlich einflussreichere Stellung der Höheren SS- und Polizeiführer in der Sowjetunion - das Polizeirecht lag dort ganz in deren Hand -, die den Spielraum von SS und Polizei in jeder Hinsicht entgrenzte, war symptomatisch für die Priorität, welche den Terrormaßnahmen im Zuge der "Gegnerbekämpfung" von höchster Stelle aus eingeräumt wurde.
- EHRI
- Archief
- de-002429-r_70_sowjetunion
Bij bronnen vindt u soms teksten met termen die we tegenwoordig niet meer zouden gebruiken, omdat ze als kwetsend of uitsluitend worden ervaren.Lees meer